Warum Bindungstrauma nicht nur persönlich, sondern auch kollektiv sind
- Marei Theunert
- 11. Sept. 2025
- 3 Min. Lesezeit

Wenn die Vergangenheit im Heute mitschwingt
Vielleicht kennst du das: Du nimmst dir fest vor, gelassen zu reagieren – und plötzlich spürst du, wie dich eine kleine Situation völlig überfordert. Dein Kind sagt „Nein!“, und du fühlst dich wie zurückgewiesen. Dein Partner zieht sich zurück, und in dir macht sich Panik breit. Oder du tust alles, um es allen recht zu machen, und merkst erst später, dass deine eigenen Bedürfnisse keinen Platz hatten.
Das sind oft keine „Übertreibungen“, sondern Spuren von Bindungstrauma. Erlebnisse aus unserer Kindheit – manchmal subtil, manchmal offensichtlich – wirken in uns nach. Sie prägen, wie wir uns selbst, andere Menschen und Beziehungen erleben.
Was ist Bindungstrauma?
Bindungstrauma entsteht, wenn die frühen Bezugspersonen für ein Kind emotional nicht ausreichend verfügbar sind. Das bedeutet nicht zwingend Gewalt oder Vernachlässigung. Oft reicht es, wenn Eltern selbst überfordert, depressiv oder in eigenen Traumata gefangen sind.
Ein Kind braucht sichere, konstante Bindung. Wenn es diese nicht erlebt, speichert das Nervensystem: „Ich bin nicht sicher. Ich muss mich anpassen, um zu überleben.“
Das kann zu verschiedenen Mustern führen – die Psychologie spricht von Bindungstypen:
Sicher gebunden: Vertrauen in Nähe & Distanz
Unsicher-ambivalent: Angst vor Verlassenwerden, klammern, hohe Emotionalität
Unsicher-vermeidend: Rückzug, „Ich brauche niemanden“, Schwierigkeiten mit Nähe
Desorganisiert: widersprüchliches Verhalten, gleichzeitig Sehnsucht und Angst vor Nähe
Diese Muster entstehen in der Kindheit – und wirken im Erwachsenenleben weiter.
Alte Muster im Alltag
Vielleicht erkennst du dich hier wieder:
Du fühlst dich schnell abgelehnt, wenn andere Grenzen setzen.
Du sagst „Ja“, obwohl du innerlich spürst: „Ich will das nicht.“
Du ziehst dich zurück, wenn es eng wird – und verstehst selbst nicht, warum.
Du hast Angst, verlassen zu werden, und klammerst dich an Beziehungen.
Das sind keine persönlichen Schwächen, sondern Überlebensstrategien, die einmal wichtig waren. Sie haben dich geschützt – und heute dürfen sie erkannt und verwandelt werden.
Warum Bindungstrauma kollektiv sind
Bindungstrauma sind nicht nur individuelle Geschichten. Sie sind kollektive Muster.
1. Transgenerationale Weitergabe
Traumatische Erfahrungen – Krieg, Flucht, Armut, emotionale Kälte – verschwinden nicht einfach mit der nächsten Generation. Sie werden weitergegeben: nicht unbedingt in Worten, sondern im Nervensystem, in Haltungen, in unbewussten Verhaltensmustern.Ein Kind spürt die unausgesprochenen Ängste der Eltern – und übernimmt sie.
2. Gesellschaftliche Prägungen
Auch unsere Kultur trägt dazu bei. Typische Sätze wie:
„Reiß dich zusammen.“
„Jungen weinen nicht.“
„Mädchen sollen brav sein.“sind kollektive Botschaften. Sie formen ganze Generationen und führen dazu, dass wir Gefühle abspalten, Bedürfnisse zurückstellen und uns anpassen.
3. Kollektive Folgen
Wenn Bindungstrauma so verbreitet ist, wirkt es auf Strukturen:
Erziehungssysteme, die Gehorsam belohnen statt Beziehung.
Arbeitswelten, die Leistung über Menschlichkeit stellen.
Gesellschaftliche Bilder von Mutterschaft oder Partnerschaft, die Überforderung normalisieren.
Das bedeutet: Bindungstrauma sind nicht nur meine persönliche Wunde. Sie sind unser aller Erbe – und genau deshalb liegt darin auch die Chance zur Veränderung.
Was das für Heilung bedeutet
Wenn wir beginnen, Bindungstrauma zu erkennen, geschieht zweierlei:
Wir hören auf, uns selbst als „defekt“ zu sehen.
Wir verstehen, dass Heilung nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich relevant ist.
Jeder Schritt in Richtung Selbstwahrnehmung, Sicherheit und Beziehung wirkt präventiv:
für die nächste Generation,
für unser Miteinander,
für eine Gesellschaft, die traumasensibel leben lernt.
Mini-Übung & Reflexion
Reflexionsfrage: Welche Sätze oder Regeln aus deiner Kindheit tauchen heute noch in deinem Alltag auf – auch wenn sie dir gar nicht guttun?
Embodiment-Impuls: Lege eine
Hand auf dein Herz. Spüre den Kontakt. Atme tief ein. Sage dir innerlich:„Heute bin ich erwachsen. Heute darf ich neue Regeln schreiben.“
Diese kleine Geste hilft deinem Nervensystem, zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu unterscheiden.
Für Fachkräfte & Begleiter:innen
Wer mit Familien, Kindern oder Erwachsenen arbeitet, begegnet Bindungstrauma immer wieder – oft ohne es so zu nennen.Traumasensibel begleiten bedeutet:
alte Muster zu verstehen, statt sie zu verurteilen,
Sicherheit im Kontakt aufzubauen,
und Räume zu schaffen, in denen neue Bindungserfahrungen möglich sind.
Genau hier setzt meine Ausbildung zur traumasensiblen Familienbegleitung an: Wir verbinden Wissen über Trauma und Bindung mit praktischen Methoden, um präventiv und heilsam zu arbeiten.
Fazit: Kollektive Heilung beginnt im Kleinen
Bindungstrauma sind keine Ausnahme – sie sind die Regel. Sie entstehen aus alten Verletzungen, die wir als Gesellschaft über Generationen weitergegeben haben.
Traumasensibel leben bedeutet, diese Muster zu erkennen, ohne Schuldzuweisungen. Es bedeutet, im Alltag kleine Schritte in Richtung Sicherheit, Beziehung und Selbstmitgefühl zu gehen.
Und es bedeutet auch: Jede:r, der diese Reise geht, trägt zur kollektiven Heilung bei.
Mehr über traumasensibles und präventives Leben erfährst du in meinem Newsletter und in den nächsten Blogbeiträgen.
Für dich persönlich: Begleitung & Impulse für den Alltag.
Für Fachkräfte: Wissen & Methoden, die deine Arbeit vertiefen.
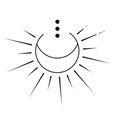_edited.png)




Kommentare